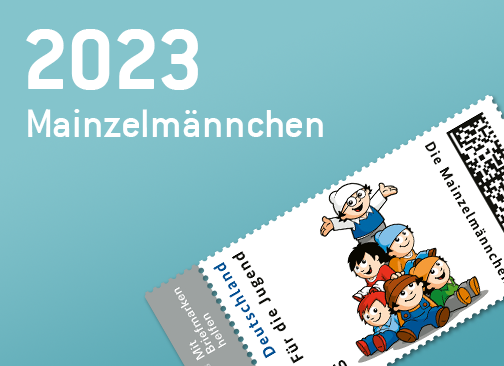1965 gründeten das Familien-, das Finanz- und das Postministerium die Stiftung Deutsche Jugendmarke als Förderorganisation für die Kinder- und Jugendhilfe. Seitdem werden Modellprojekte, der Neu-, Um- sowie Ausbau außerschulischer Bildungsorte und wissenschaftliche Studien aus dem Erlös der jährlich erscheinenden Briefmarkenserie „Für die Jugend“ unterstützt – mit bislang mehr als 200 Milionen Euro.
Projekte, Lernorte und Forschung
Aktuelles

Für die Jugend 2023: Die Mainzelmännchen
Anton, Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen treten im Jahr ihres 60. Geburtstags an, um Briefe UND gute pädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche auf den Weg zu bringen.

Jahresbericht 2022
Informationen über zuletzt geförderte Projekte und die Arbeit der Stiftung Deutsche Jugendmarke bietet der aktuelle Jahresbericht.

Innovation für die Jugend
Zukunftsweisende Projekte sind impulsgebend für die Kinder- und Jugendhilfe. Innovative Ideen werden von der Stiftung Deutsche Jugendmarke unterstützt, wenn sie Vorbilder für weitere Projekte schaffen.
Bauen für die Jugend
Vom Medienzimmer bis zum Therapiezentrum für gewaltgeschädigte Kinder und Jugendliche – Räume, die Kindern und Jugendlichen Platz für Entwicklung bieten, schaffen die Voraussetzungen für eine erfolgreiche pädagogische Arbeit.


Forschen für die Jugend
Forschungsvorhaben, Fachtagungen und Schulungen sind eine Basis erfolgreicher Kinder- und Jugendhilfe und daher ein weiterer Förderschwerpunkt.
Kleine Marken, große Wirkung
Jedes Jahr kommt eine neue Serie Jugendmarken heraus. Ob Traktoren, die Mainzelmännchen oder Feuerwehrfahrzeuge: Hingucker sind die abwechslungsreichen Motive immer!
Im Briefmarken-Shop gibt es außer den Bestellmöglichkeiten für die Marken und verschiedene philatelistische Sammelobjekten wissenswerte Infos zu den Motiven.